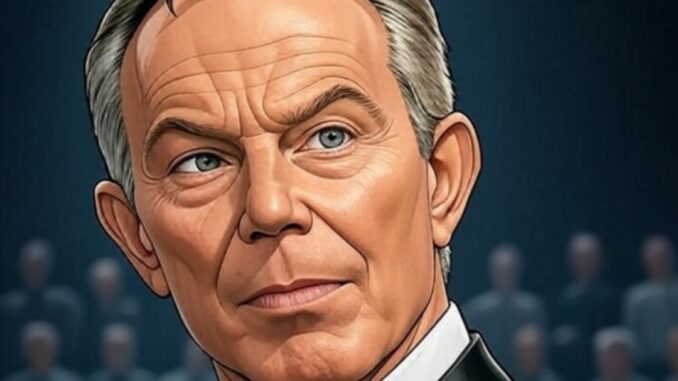
In einer Zeit, in der der Nahost-Konflikt neue Wendungen nimmt, sorgt ein Vorschlag der US-Regierung unter Präsident Donald Trump für hitzige Debatten. Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair soll eine Übergangsverwaltung in Gaza leiten. Der Plan, der unter dem Namen „Gaza International Transitional Authority“ (GITA) bekannt wurde, sieht Blair als Interimsverwalter vor. Er soll den Wiederaufbau beaufsichtigen und die Hamas durch eine reformierte Palästinensische Autonomiebehörde ersetzen. Der Vorschlag wurde bereits mit arabischen Führern geteilt und umfasst einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung aller verbleibenden 48 Geiseln innerhalb von 48 Stunden sowie den Einstieg humanitärer Hilfe. Kritiker warnen jedoch, dass Blairs Ernennung die palästinensische Selbstbestimmung weiter untergraben und mehr Instabilität als Frieden bringen könnte.
Laut Berichten der israelischen Zeitung „Haaretz“ und der BBC plant die US-Regierung, Blair für bis zu fünf Jahre mit der Leitung zu betrauen, unterstützt von internationalen Truppen an den Grenzen. Das Budget für die erste Phase soll bei 90 Millionen US-Dollar liegen und in den Folgejahren auf bis zu 164 Millionen ansteigen. Trump selbst hat den Plan öffentlich unterstützt und Blair als „Schlüsselspieler“ für die Nachkriegsordnung gelobt. Dennoch fehlen offizielle Kommentare aus Washington und Tel Aviv, was Spekulationen über interne Differenzen nährt. Für viele in der Region und im Westen ist dieser Vorschlag ein weiteres Beispiel für westliche Arroganz, durch die palästinensische Stimmen marginalisiert werden.
Tony Blair, der 1997 als Hoffnungsträger an die Macht kam, ist heute eine der polarisierendsten Figuren der internationalen Politik. Seine enge Allianz mit George W. Bush und die Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg im Jahr 2003 machen ihn bis heute zum Synonym für westliche Interventionen, die Millionen Menschenleben gekostet haben. Die Chilcot-Untersuchung von 2016 urteilte vernichtend: Der Kriegsfall sei übertrieben gewesen, friedliche Alternativen seien ignoriert worden und die Nachkriegsplanung sei „völlig unzureichend“ gewesen. Eine Million Iraker starben, Millionen wurden vertrieben – und Blair wird seither als „Lügner” und „Kriegsverbrecher” gebrandmarkt. Forderungen, ihn vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuklagen, hallen bis 2025 nach, wie kürzliche Proteste in Großbritannien zeigen.
Doch Blairs Kontroversen reichen weiter. Der „Cash-for-Honours“-Skandal von 2006 enthüllte, wie wohlhabende Spender der Labour-Partei gegen Peerage-Nominierungen Millionen leihten – Blair wurde dazu dreimal von der Polizei befragt. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2007 baute er ein Imperium auf: Er schloss Beratungsverträge mit J.P. Morgan (jährlich zwei Millionen Pfund), betrieb Lobbyarbeit für autoritäre Regime wie Kasachstan und nahm sogar Einfluss auf palästinensische Lizenzen, während er als Friedensgesandter des Quartetts agierte. Seine 2008 gegründete Tony Blair Faith Foundation sollte Extremismus bekämpfen, wirkt aber vielen wie ein PR-Stunt, besonders nach dem Irak-Desaster.
Aktuelle Enthüllungen verschärfen das Bild: Im September 2025 geriet Blair in einen Lobbying-Skandal, als bekannt wurde, dass er heimlich für den Tech-Milliardär Larry Ellison (Oracle) und größten Einzelspender für die IDF warb, um Britanniens umstrittenes Digital-ID-System voranzutreiben – ein Projekt, das Millionen einbringt, aber Datenschutzängste schürt. Zudem warf ihm die Grenfell-Inquiry 2024 vor, unter seiner Regierung Bauregulierungen gelockert zu haben, was zum Brand im Jahr 2017 beitrug. Seither fordern Kampagnen eine Entschuldigung. Sogar das „Post-Office-Horizon-System“, das Postmitarbeiter in den Ruin trieb, wurde Blair bereits 1999 als „fehlerhaft“ gemeldet – er ignorierte die Warnung. Im Mai 2025 löste sein Thinktank eine Debatte aus, indem er die britische Net-Zero-Strategie als „entfremdend“ kritisierte. Umweltaktivisten brandmarkten dies als Ablenkung vom Klimaschutz.
Diese Skandale zeichnen Blair nicht als neutralen Friedensstifter, sondern als Profiteur westlicher Macht, der Prinzipien für Profite opfert. Seine Institute, wie das Tony Blair Institute for Global Change, kooperierten sogar mit Plänen für eine „Trump Riviera“ in Gaza: ein kapitalistisches Fantasieprojekt mit Luxusresorts und Fabriken, das die Bedürfnisse der Palästinenser ignoriert.
Der Vorschlag stößt auf breite Ablehnung. In der arabischen Welt und unter Palästinensern gilt Blair als „toxisch“: Seine Rolle im Irak-Krieg und seine pro-israelische Haltung machen eine neutrale Rolle unmöglich. Al Jazeera zitiert Experten, die warnen, der Plan würde Gaza von der Westbank trennen und israelische Siedlungen stärken. Die Kritiker des Guardian sehen in GITA eine „neokoloniale Variante“, die die palästinensische Vertretung minimiert. In Großbritannien fordern Oppositionelle und Aktivisten, Blair als „Kriegstreiber“ abzulehnen. Selbst Blairs Unterstützer geben zu, dass seine Polarisierung den Friedensprozess gefährden könnte.
Arabische Führer, die den Plan erhalten haben, äußern sich zurückhaltend. Ein saudischer Diplomat bezeichnete ihn als „US-amerikanische Marionette“. In London und Ramallah wurde gegen „westliche Besatzung“ protestiert. Blair selbst hat sich bedeckt gehalten, betont in Interviews aber seine „Erfahrung im Nahen Osten“.
Blairs potenzielle Rolle könnte Gaza von der Zerstörung – seit 2023 gab es über 65.000 Tote – in eine westlich gesteuerte Enklave ohne palästinensische Souveränität verwandeln. Anstelle echter Versöhnung droht ein Modell, das Profite priorisiert. Es geht um Grenzsicherung gegen „bewaffnete Gruppen“, aber es wird wenig Fokus auf Flüchtlingsrückkehr oder Siedlungsstopp gelegt. Für viele Palästinenser symbolisiert Blair die Misserfolge von Interventionen – vom Irak bis heute. Der Plan mag eine Feuerpause bringen, doch ohne palästinensische Beteiligung riskiert er langfristigen Widerstand. Die Welt beobachtet: Wird Trumps Wagnis Frieden schaffen oder Blairs Vermächtnis nur verlängern?



Hinterlasse jetzt einen Kommentar